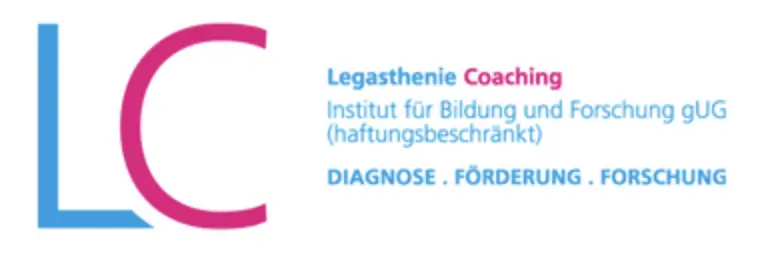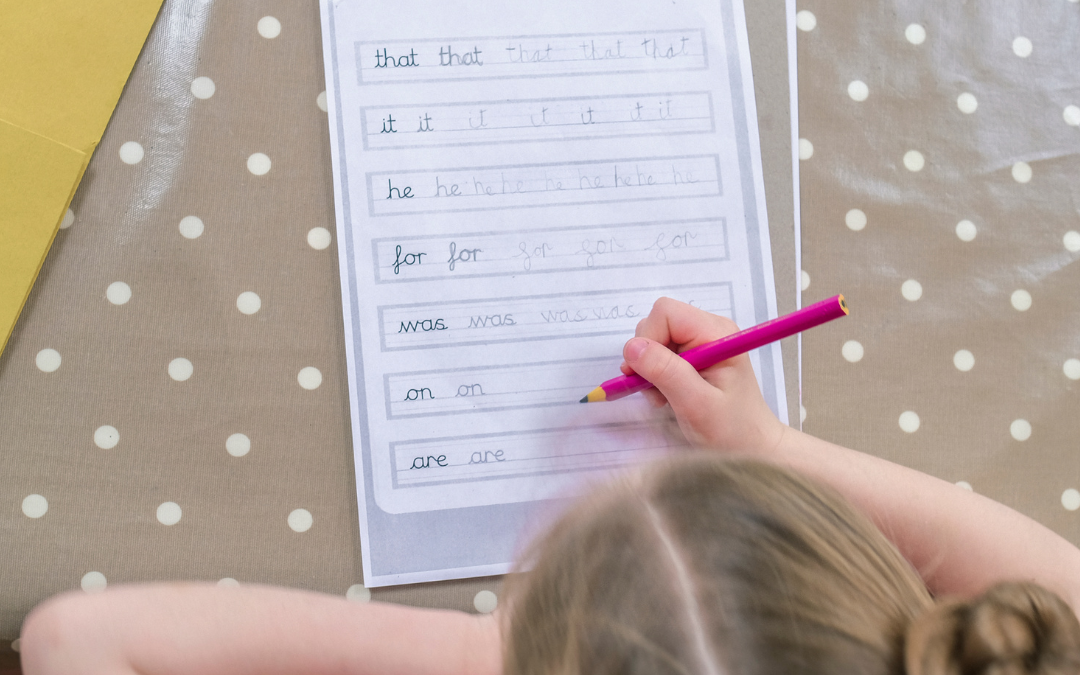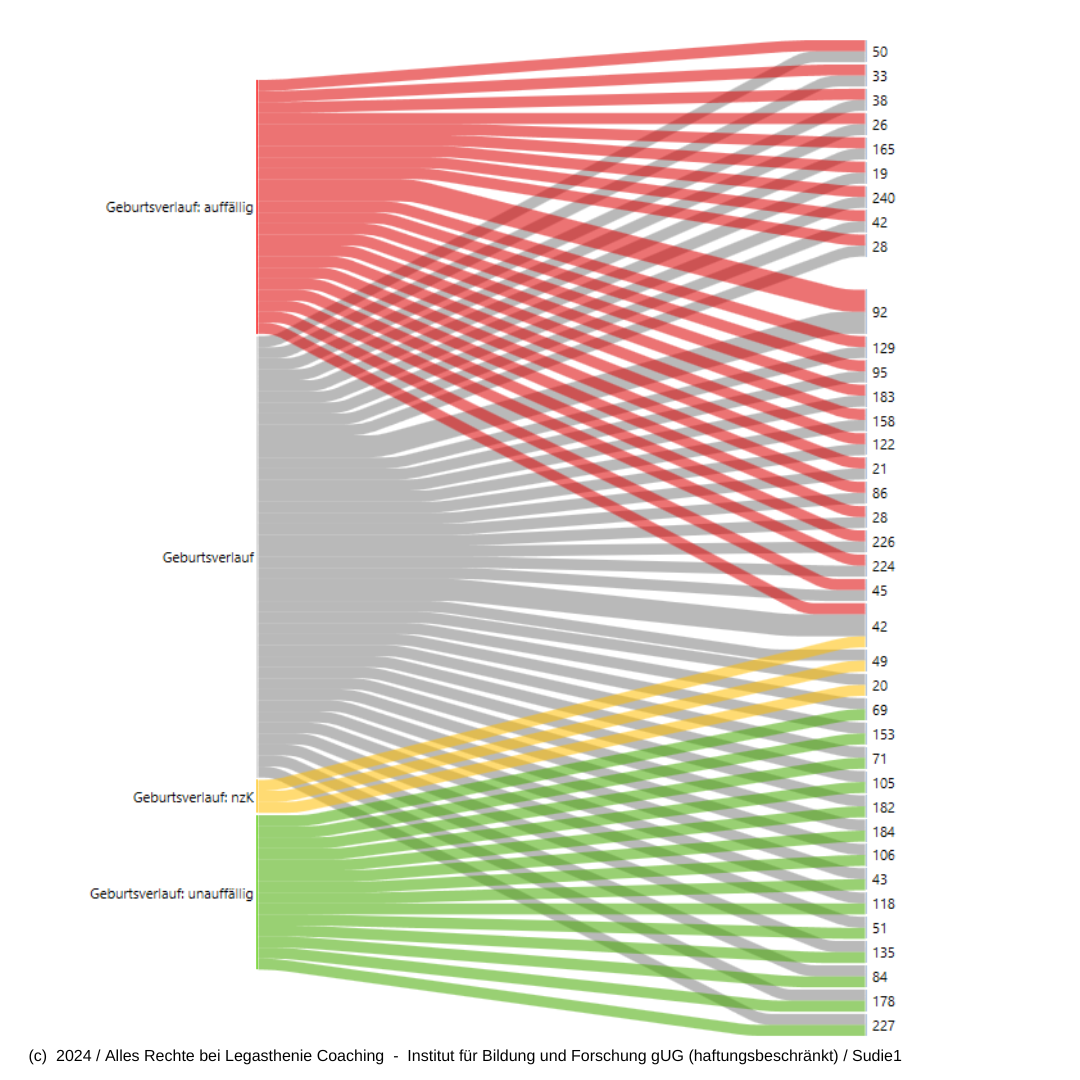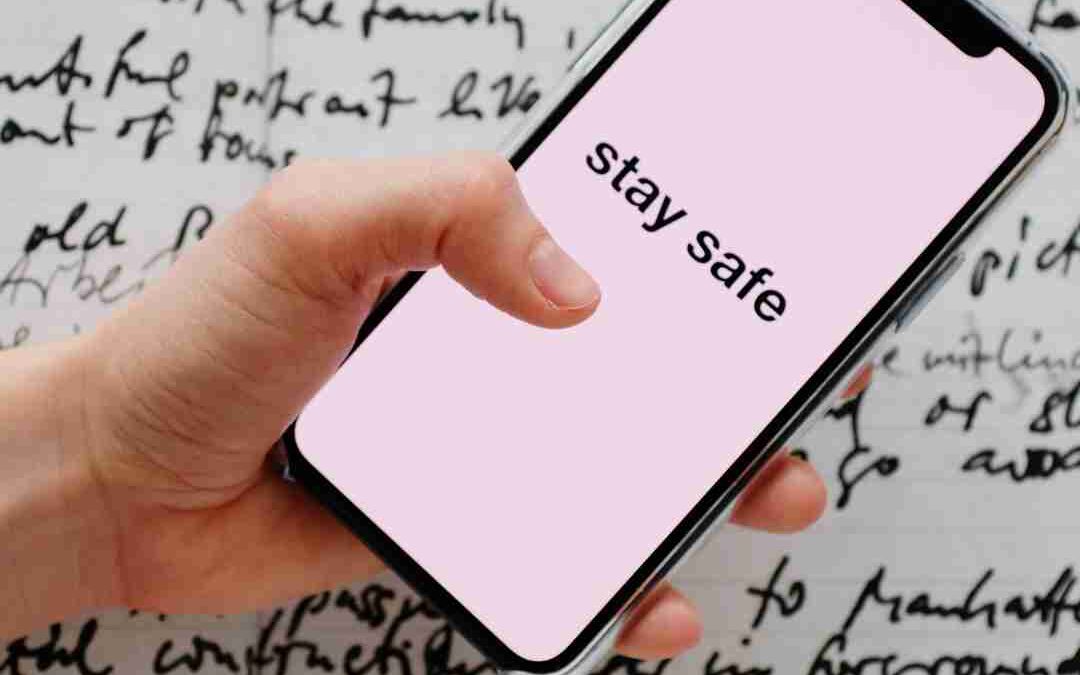
Hier haben Sie die Möglichkeit uns mit einer direkten Spende gern projektbezogen zu unterstützen.
Unser Spendenkonto:
Triodos Bank N.V. Deutschland
IBAN: DE80 5003 1000 1027 8930 03
BIC: TRODDEF1
VERWENDUNGSZWECK: z. B. „Spende“ ,“Forschung“, „Sozialfonds“, „Aufklärungsarbeit“.
Unser Paypal-Spendenkonto:
zu Paypal
Natürlich können Sie gern projektbezogen spenden. Geben Sie dafür bitte bei der Überweisung das gewünschte Projekt im Verwendungszweck an – wir ordnen die Spende dann entsprechend zu.
Für jede Spende kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden, denn Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar.
Kontaktieren Sie uns dazu einfach über unser Kontaktformular oder Rufen Sie uns gern an, wenn Sie uns unterstützen möchten.