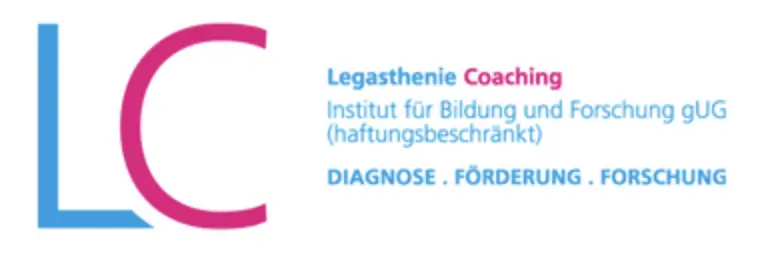von Legasthenie Coaching | Aug 15, 2024 | Legasthenie, LRS
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Blogbeitrag! Heute möchten wir über Legasthenie und Lerntherapie sprechen und wie Eltern eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung ihrer Kinder spielen können. Wenn du als Elternteil ein Kind hast, das mit...
von Legasthenie Coaching | Mai 3, 2024 | Legasthenie, LRS, Rategber
Ein Blogbeitrag von Lars Michael Lehmann (Legasthenie-Experte & Fachjournalist, Gründer von Legasthenie Coaching) Heute möchten wir Eltern von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche / LRS ermutigen und unterstützen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die...

von Legasthenie Coaching | Mai 11, 2023 | Fachartikel, Forschung, Legasthenie, LRS
Oft stehen Eltern vor der Herausforderung, eine passende Schule für ihr Kind zu finden. Dabei sind Schulen in freier Trägerschaft bei Familien mit Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwächen besonders beliebt. Objektiv betrachtet, bieten solche Schulen keine Garantie für...
von Legasthenie Coaching | Apr 13, 2023 | Fachartikel, LRS, Rategber
Seitdem sich Fachleute mit dem Thema LRS und Legasthenie befassen, werden die sozialen Umweltbedingungen als Ursache und wichtiger Punkt zu ihrer Bewältigung diskutiert. Dabei spielt die Erziehung eine wichtige Rolle (Legasthenie Coaching, 2018). In diesem Artikel...
von Legasthenie Coaching | Dez 9, 2021 | LRS, Fachartikel, Legasthenie, Rategber
Rezension: Ratgeber Rechtschreibprobleme (LRS/Legasthenie) Heute wollen wir das Buch „Ratgeber Rechtschreibprobleme (LRS/Legasthenie)“ von Dorothea und Günther Thomè besprechen. Dieser Ratgeber erschien im Verlag des isb – Institut für sprachliche Bildung...