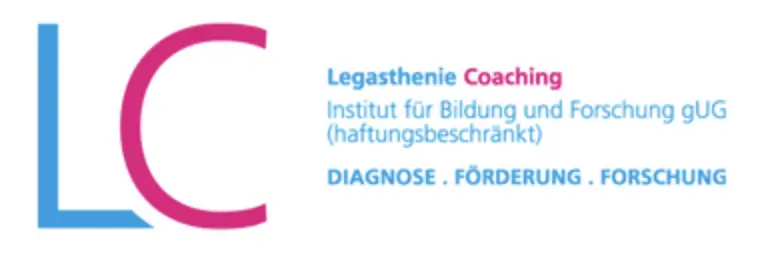Legasthenie Coaching
Expertenhilfe bei LRS, Legasthenie und Dyskalkulie,
sowie Hochbegabung
Beratung
Diagnose
Lerntherapie & Coaching
Forschung
Leistungen
Dann nutzen Sie unsere kompetente Erfahrung in den Bereichen Beratung, Diagnose und Lerntherapie sowie Forschung.

Beratung
Möchten Sie Ihrem Kind mit einer Beratung helfen, wenn es schon lange mit Lesen, Schreiben oder Rechnen zu kämpfen hat?
Sind Sie unsicher, ob es möglicherweise an einer Lernschwäche leidet und möchten sich dazu informieren?
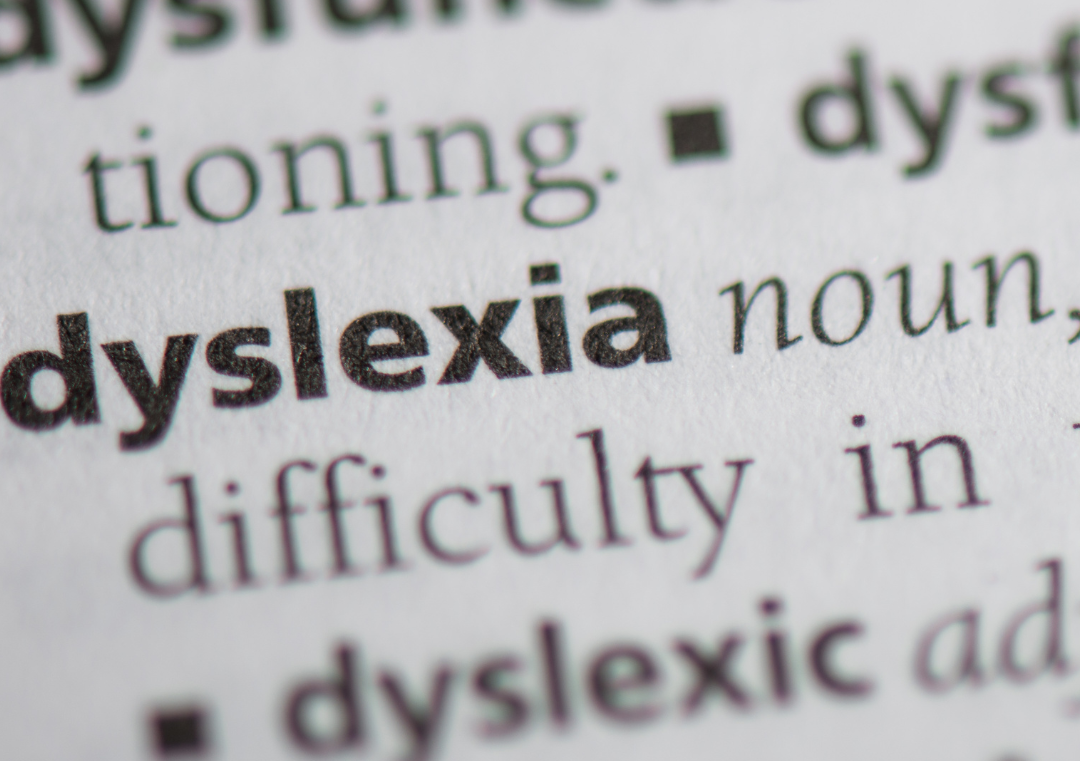
Diagnose
Zuerst ist es wichtig, genau herauszufinden, welche Schwierigkeiten oder Stärken jemand beim Lesen, Schreiben und Rechnen hat.
Dafür suchen wir nach den Gründen für die Lernprobleme.
Hierfür benötigen wir eine ausführliche Diagnose, um den möglichen Ursachen der vermuteten Schwäche auf den Grund zu gehen.

Lerntherapie & Coaching
Mit unserer Expertise in Lerntherapie und Coaching bieten wir fundierte Diagnostik bei LRS, Legasthenie und Dyskalkulie an, basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Wir identifizieren präzise Herausforderungen im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie Hochbegabung und erstellen unabhängige Gutachten für Schüler, Auszubildende und Studierende.

Forschung
Unser Institut ist führend in der unabhängigen wissenschaftlichen Erforschung von Legasthenie, Dyskalkulie und anderen Lernschwierigkeiten, insbesondere in Verbindung mit Hochbegabung.
Wir gehen über die herkömmlichen Betrachtungsweisen aus pädagogischer und medizinischer Sicht hinaus und integrieren aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Linguistik, Medizin und Soziologie in unsere Forschungsarbeit.
Unser Institut
Legasthenie Coaching – gemeinnützige Bildungs- und Forschungseinrichtung
Unser Institut gibt es bereits seit 2010 in Dresden und wurde von dem bekannten Legasthenie-Experten und Fachjournalisten Lars Michael Lehmann gegründet. Der Gründer ist selbst Legastheniker und bereits heute für seine Expertise im deutschsprachigen Raum bekannt. Er zählt zu den führenden Experten auf diesem Fachgebiet.
Das Legasthenie Coaching ist eine gemeinnützige Bildungs- und Forschungseinrichtung. Wir bieten Beratung und Diagnostik bei Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), Legasthenie und Dyskalkulie, auch in Verbindung mit Hochbegabung. Darüber hinaus bieten wir spezielle lerntherapeutische Einzelförderung an.
Erfahre mehr über uns
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Begleitung von erwachsenen Legasthenikern. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Diagnostik und im Coaching von Fach- und Führungskräften, auch in Zusammenarbeit mit internationalen Großkonzernen.
Zudem sind wir Pioniere in der Legasthenieforschung und erforschen die Ursachen und Biografien der betroffenen Personen in unseren Studien.
Wir arbeiten mit Verbänden, internationalen Organisationen, Schulen in freier oder öffentlicher Trägerschaft, der International School Dresden und Universitäten wie der TU Dresden sowie der IHK und der HwK zusammen.
Die Arbeit unseres Instituts zählt zu den führenden auf diesem Fachgebiet und zeichnet sich durch ihre fortschrittlichen Ansätze aus.
FAQs
Was ist Legasthenie Coaching?
Was ist Legasthenie und LRS oder Dyslexia?
LRS uns Legasthenie? → Hier mehr erfahren.
Dyskalkulie / Dyslexia / Rechenschwäche? → Hier mehr erfahren.
Was sind die Ursachen für LRS und Legasthenie?
Zuerst muss gesagt werden, dass bis heute viele Ursachen nicht ausreichend erforscht sind. Die Grundlagenforschung hat da noch großen Nachholbedarf. Mögliche Ursachen können sein:
- Erbliche Anlagen, die häufiger bei Familien vorkommen,
- neurologische Besonderheiten / Arbeitsgedächtnis,
- Sprachentwicklung,
- motorische Entwicklung,
- seelische Gesundheit,
Möglich sind auch Störungen bzw. Beeinträchtigungen bei folgenden Teilleistungen:
- Hörverarbeitung / Audiovisuelle Wahrnehmungsstörung (AVWS)
- Sehverarbeitung / Visuomotorik (keine Winkelfehlsichtigkeit, diese ist wissenschaftlich nicht belegt)
- Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, die häufig mit ADHS oder ADS in Verbindung gebracht wird
- Körpergefühl
- Raumlage
Die beschriebenen Teilleistungen können zu den vermuteten Lese-Rechtschreib-Schwächen führen. Deshalb verwenden Fachleute auch die Begriffe Wahrnehmungsstörung bzw. Teilleistungsschwäche. Das Thema ADS oder ADHS ist dabei sehr umstritten, es ist zu bezweifeln, dass diese Störungen so häufig auftreten, wie sie heutzutage diagnostiziert werden.
Umweltursachen in den Familien, die sich auf die Lernschwierigkeiten auswirken können:
- Unzureichende Lernanreize,
- Erziehungsprobleme oder Erziehungsfehler,
- Sprachliche Erziehung,
- Mehrsprachigkeit,
- Medienkonsum,
- Sozialverhalten,
- Psychische Stabilität,
- Selbstwertgefühl,
- Psychische Erkrankungen der Eltern,
- Bildungshintergrund der Eltern,
- Familiärer Rückhalt,
- Soziale Benachteiligung,
- Traumatische Erfahrungen,
- Ernährung u.v.m.
Schulische Umweltfaktoren
- Qualität des Deutschunterrichts / Lernmethodik (Schweizer-Modell),
- Klassenklima und Klassengröße
- Häufiger Schulwechsel,
- Vermehrter Ausfall wegen Krankheit,
- Stundenausfall,
- Mobbing u.v.m.
Für eine differenzierte Diagnose und Förderung ist es wichtig, über diese möglichen Ursachen Bescheid zu wissen. Darum muss immer eine ausführliche Anamnese der Ursachen stattfinden, zusätzlich neben den gängigen standardisierten Lese-Rechtschreib-Tests sowie ggf. sprachfreien IQ-Tests (CFT 1 und CFT 20-R).
Ist Legasthenie oder LRS eine Krankheit oder Behinderung?
Diese Störbilder stigmatisieren nicht nur die Betroffenen, sondern sie wirken sich auch hinderlich auf die seelische Entwicklung der Betroffenen aus. Darauf folgt nicht selten eine Selbststigmatisierung, die gravierende Folgen haben kann. Daraus können dann depressive Verstimmungen und andere seelische Erkrankungen entstehen. Langfristig können daraus seelische Behinderungen entstehen, darum sollte eine medizinische Legasthenie-Diagnose kritisch hinterfragt werden, ob sie den Betroffene etwas nützt. Denn Lese-Rechtschreib-Probleme haben häufig komplexere Ursachen. Wichtiger ist es, Betroffene vor einer seelischen Behinderung zu bewahren.
Ist eine Legasthenie oder LRS heilbar?
Mein Kind hat Lese-Rechtschreib-Probleme. Das wurde aber im LRS-Feststellungsverfahren nicht erkannt?
Es gibt unterschiedliche Ursachen, warum Kinder beim schulischen LRS-Feststellungsverfahren nicht deutlich genug erkannt wurden. Einer der Gründe kann sein, dass dieser Test mithilfe von Gruppentestungen vorgenommen wird, was zu Ungenauigkeiten führen kann. Dann kann es an den Testverfahren liegen, die häufig alte Normierungen (älter als 10 Jahre) haben oder in der Forschung nicht mehr angewandt werden, weil sie nicht aussagekräftig (Validität) genug sind. Oder es fehlt an der notwendigen Repräsentativität, d.h. es wurden keine Testnormen genommen, die das Bundesland Sachsen repräsentieren oder eine ausreichende Testanzahl haben. Dadurch kann es zu Normverschiebungen kommen, und Fehleinschätzungen sind ein mögliches Ergebnis. Darum lohnt es sich nochmals eine unabhängige Einzeltestung durchzuführen.
Allgemein ist von einer hohen Fehleranfälligkeit bei LRS-Feststellungen im Bildungswesen auszugehen, weil man häufig nur auf die Symptome schaut und nicht auf die Ursachen.
Lesen Sie dazu unser Interview beim MDR von Lars Michael Lehmann, Legasthenie-Experte: Legasthenie-Förderung: „Man nimmt Symptome wahr, aber guckt zu selten auf die Ursachen“.
Wer bezahlt die Kosten einer Diagnostik und Lerntherapie & Coaching?
Wie bekomme ich Unterstützung vom Jugendamt?
Sollten Sie trotz der Probleme keine Förderung von staatlicher Seite erhalten, müssen sie eine Einzelförderung privat zahlen oder können bei uns einen Antrag auf Unterstützung stellen.
Wenn ich mir keine Förderung für das Kind leisten kann, wer hilft mir dann?
Es passiert häufig, dass sozial schwächere Familien keine Hilfe von staatlicher Seite erhalten. Angenommen, Sie sind eine alleinerziehende Mutter und haben nur ein geringes Gehalt oder beziehen Arbeitslosengeld oder andere Sozialleistungen. Dann können Sie bei uns einen formlosen Antrag auf Unterstützung stellen, wenn Sie uns ihre finanzielle Lage in Form von Bescheiden nachweisen. Dann besteht die Möglichkeit, dass Sie ein geringeres Entgelt für die Diagnostik und Förderung bezahlen können.
Wann sollte mein Kind auf LRS getestet werden?
Kann mein Kind gezwungen werden in eine LRS-Klasse zu gehen?
Ihr Kind kann rechtlich nicht dazu gezwungen werden auf eine LRS-Klasse zu gehen, die Schulen sollten Sie im Normalfall über alternative Wege der Einzelhilfe aufklären. Uns sind einige Fälle bekannt, wo Eltern unter Druck gesetzt wurden, Ihr Kind auf eine LRS-Klasse zu schicken. Diesem Druck brauchen Sie nicht nachzugeben, im Zweifelsfall suchen Sie das Gespräch mit einem Vertrauenslehrer. Funktioniert das nicht, können Sie sich Rat bei einem Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht suchen, dieser klärt sie detaillierter über ihre Rechte auf.
Erfahrungsgemäß liegt die Entscheidung für eine LRS-Klasse immer bei den Erziehungsberechtigten. Eltern sollten sich über die Vor- und Nachteile einer Sonderklasse informieren. Sprechen Sie mit anderen Eltern über die gesammelten Erfahrungen, dazu sollten Sie das betroffene Kind mitentscheiden lassen, ob es in eine LRS-Klasse gehen möchte oder im Klassenverband bleiben will.
Weiterführende Berichte zum Thema LRS-Klasse:
- Erlebnisbericht über einen Schüler einer LRS-Klasse
- LRS-Klassen und ihre Langzeitwirkungen
- Mein Kind will in keine LRS-Klasse gehen
- Warum ist das Thema LRS-Klasse ein viel diskutiertes Thema?
- Warum sind LRS-Klassen aus wissenschaftlicher Sicht umstritten?
- Ein Beispiel: Wie ein Schüler ohne LRS-Klasse erfolgreich das Gymnasium schafft
Was könnte eine LRS-Klasse für Nachteile haben?
LRS-Klassen bedeuten eine Separation ab der 3. Grundschulklasse, die Schüler müssen ihre bisherige Klasse verlassen. Es kann ein Nachteil sein, wenn man Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwächen in eine Art Sonderschule separiert. Langfristig kann dieses LRS-Etikett nachteilige Auswirkungen auf die psychische Entwicklung haben. In Zeiten der Inklusion sind LRS-Klassen eine veraltete Herangehensweise, um Kinder mit LRS oder Legasthenie bestmöglich zu fördern.
Wir kennen einige Biografien von Erwachsenen, die unter dieser Separation psychisch gelitten haben. Die Legasthenieforschung fordert grundsätzlich eine individuelle 1 : 1 Förderung und Begleitung, damit Betroffene ihre Lese-Rechtschreib-Schwäche gut bewältigen können. LRS-Klassen gibt es nur in Thüringen und Sachsen, in den alten Bundesländern kennt man diese Sonderklassen nicht.
Familien mit Ihren Kindern müssen sich über die Vor- und Nachteile dieser LRS-Klassen informieren, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Wie lange dauert eine Lerntherapie?
Kann man eine LRS oder Legasthenie im Erwachsenenalter feststellen?
Wie lange dauert es, bis sich Lernfortschritte durch eine Einzelförderung zeigen?
Wie sieht eine Einzelförderung im Detail aus?
Nicht nur die Fehlersymptomatik soll dabei berücksichtigt werden, sondern die gesamte persönliche Entwicklung des Schützlings muss gefördert werden. Manche brauchen viel Wertschätzung, um das Selbstwertgefühl aufzubauen. Andere wiederum brauchen Förderung in der Motorik, Sprache, Sozialverhalten, Motivation und Durchhaltevermögen sowie Konzentration u.v.m. Dazu kommen Leseübungen und individualisierte Übungen für die Orthografie und Grammatik. Dies kann mit unterschiedlichen kreativen Lernspielen, Übungsblättern und weiteren Trainingseinheiten ergänzt werden.
Welche Berufe kann ich als Betroffener erlernen?
Sollten Erwachsene eine Einzelförderung und Coaching beginnen?
Besteht eine Chance, als Erwachsener seine Lese-Rechtschreib-Schwäche zu bewältigen?
Kann ich mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche studieren?
Was sind die Vor- und Nachteile eines Nachteilausgleichs?
Rechtlich gesehen geht es bei Nachteilsausgleichen darum, einen Bewertungsnachteil der schulischen Leistungen auszugleichen, sodass Schüler trotz LRS, Legasthenie sowie Rechenschwäche (Dyskalkulie) entsprechend ihrer sonstigen Begabung bewertet werden.
Beispielsweise erhalten Schüler mehr Zeit bei Klassenarbeiten/Prüfungen (Ausbildung und Studium) in Deutsch oder Mathematik bzw. in festgelegten schul- und prüfungsrelevanten Fächern. Oder sie erhalten die Möglichkeit, technische Hilfsmittel (Spracherkennung, Rechtschreibhilfen am PC etc.) einzusetzen.
Die LRS-Erlasse, die auch die Nachteilsausgleiche regeln, sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Es gibt auch kein einheitliches Vorgehen, wie die Schulen das praktisch umsetzen. In der Berufsbildung ist dies in den Prüfungsverordnungen der IHKs oder Handwerkskammern geregelt. An Hochschulen und Universitäten gibt es je nach Fakultät eigene Regelungen und Vorgehensweisen.
Vorteile:
- Für das Kind mit LRS oder Legasthenie kann der Ausgleich eine Entspannung bringen.
- Das Kind hat mehr Zeit bei Klassenarbeiten und kann sich dadurch besser konzentrieren.
- Der Ausgleich kann einen Vorteil ermöglichen, wenn durch bessere Gesamtnoten, der Übergang zur weiterführenden Schule ermöglicht wird. Hier geht es insbesondere um die Entscheidung Gymnasium oder Oberschule.
- Der Nachteilsausgleich kann von Eltern und Lehrern unter Hinzuziehung von Fachleuten ausgehandelt werden. Dieser wird alle 6 Monate mit der Schule besprochen und aufs neue bewährt.
Nachteile:
- Eine festgestellte LRS oder Legasthenie wird meistens in der Schülerakte vermerkt und kann, die schulische Entwicklung des Betroffenen verbauen, wenn im Abschlusszeugnis „LRS oder Legasthenie“ steht.
- Abweichende Benotungen können von den Mitschülern, die keine LRS oder Legasthenie haben, als Bevorzugung der betroffenen Schüler gesehen werden. Folgen davon können sein, dass die bevorzugten Schüler Außenseiter werden, gehänselt oder gemobbt werden. Einige Kinder entwickeln deswegen psychosoziale Verhaltensprobleme (Ängste, Leistungsverweigerung, Depressionen, Konzentrationsprobleme etc.).
- Ohne individuell zugeschnittenen Nachteilsausgleich kann dieser für den Schüler demotivierende Auswirkungen haben, was sich auf die persönliche Entwicklung negativ auswirken kann.
Schlussbemerkung: Die Anerkennung eines Nachteilsausgleiches wird von den Schulen trotz der vorhandenen Verwaltungsvorschriften unterschiedlich gehandhabt. Strittig ist, dass Schüler eine schulrechtliche umschriebene Lernstörung vorweisen müssen, um einen rechtlichen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich zu erhalten. Manche Betroffene müssen dafür eine ärztlich festgestellte seelische Behinderung vorweisen, was aus ethischen Gesichtspunkten als Verletzung der Menschenwürde betrachtet werden kann. Eine seelische Behinderung ist in diesem Fall selten objektiv feststellbar, da nur wenige Kinder wirklich schon im frühen Kindesalter psychische Probleme davongetragen haben.
Schulen haben häufig neben einer medizinischen Diagnose einen Nachteilsausgleich zu gewähren, darüber können Sie mit dem Vertrauenslehrer oder Klassenleiter sprechen.
Für Erwachsene:
Nachteilsausgleiche klingen für manche Betroffenen bequem, weil sie meinen, sie könnten sich mit einem Attest zurückzulehnen. Wichtiger ist es, etwas gegen diese Schwierigkeiten zu unternehmen und die Schwäche mit einer Förderung in den Griff zu bekommen. In meisten Fällen kann die Schwäche recht gut kompensiert werden, was sich auch auf die persönliche Entwicklung positiv auswirkt. Erwachsene werden selbstbewusster, wenn sie besser im Lesen und Schreiben werden. Darum darf der Nachteilsausgleich nicht aus Bequemlichkeit erwogen werden. Daher kann man auch die Skepsis mancher Prüfungskommissionen bei Beantragung des Nachteilsausgleiches nachvollziehen. Zuerst sollten alle möglichen zusätzlichen Hilfen für eine Bewältigung einer Schwäche ausgeschöpft sein, bevor der Ausgleich beantragt wird.
Wie können wir Legasthenie Coaching unterstützen?
Kontaktieren Sie uns
Suchen Sie fachkundige Beratung und Unterstützung bei LRS, Legasthenie oder Dyskalkulie? Dann sind Sie bei uns richtig – nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
Telefonnummer
0351 8 999 15 90
E-Mail-Adresse
Standort
Bamberger Str. 7
01187 Dresden